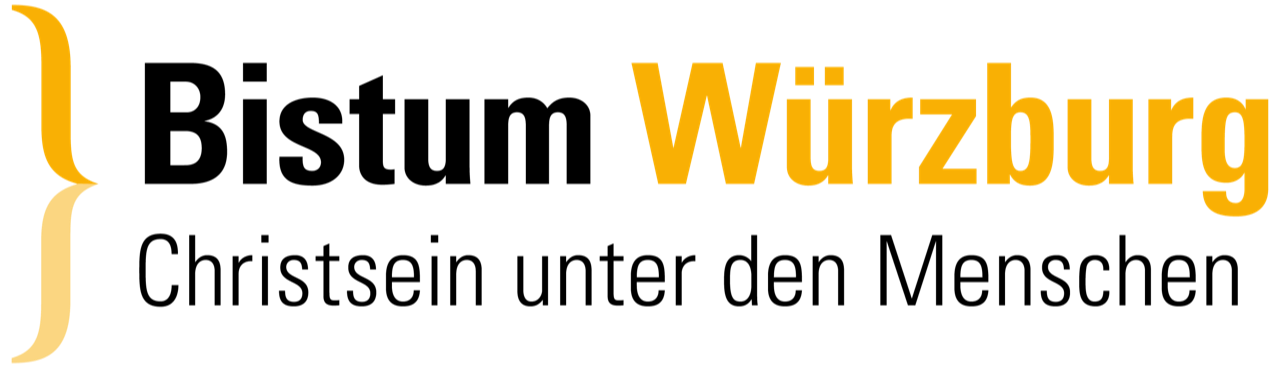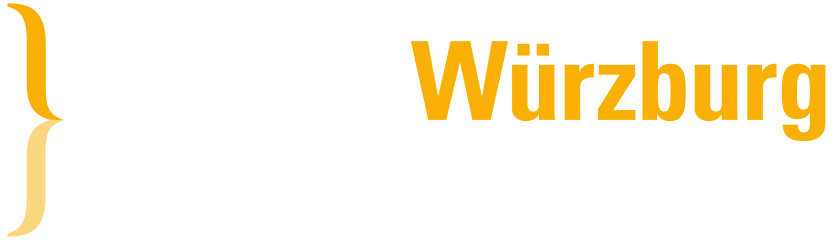Würzburg (POW) Nicht alle Milieus werden von der Kirche erreicht. Diese Sprachlosigkeit gilt es anzuerkennen und sich mit den Lebensräumen der nicht erreichten Milieus vertraut zu machen. „Wir müssen die Sprache der anderen lernen, um benennen zu können, wo Gott dort schon präsent ist“, hat der Salzburger Dogmatiker Professor Dr. Hans-Joachim Sander am Samstag, 30. September, bei einer Studientagung der Katholischen Akademie Domschule zum Thema „Wo lebt die Kirche?“ betont.
Ausgangspunkt von Sanders Betrachtungen war die vom Heidelberger Sinus-Institut erstellte Sinus-Milieu-Studie, die Bernhard Spielberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Universität Würzburg, vorstellte. Diese unterscheidet zehn verschiedene Milieus in Deutschland, die hart voneinander getrennt leben. Sie differenzieren sich nach sozialer Klasse (Unter-, Mittel-, Oberschicht) und Grundorientierung (Traditionelle Werte, Modernisierung, Neuorientierung). Nur Konservative (gebildet, kulturkritisch, etikette- und pflichtbewusst), Traditionsverwurzelte (häuslich, bescheiden, viele Rentner, mittleres Bildungsniveau) und bürgerliche Mitte (familienfreundlich, statusorientiert, auf Sicherheit bedacht) werden noch von der Kirche erreicht, sagte Spielberg. Zu den kirchenfernen Gruppen zählten nicht primär die DDR-Nostalgiker, die Etablierten und die Postmateriellen. Vielmehr seien es die beiden Unterschicht-Milieus der Hedonisten und der Konsum-Materialisten, aber auch die modernen Performer, die jung, leistungsfixiert und gebildet sind.
Sander postulierte ein differenziertes Urteil zu diesem Befund. Auch wenn Kirche und Religion wieder mehr in das öffentliche Interesse rückten: Kirche erlebe deswegen nicht automatisch eine Renaissance als Autorität. Ihr Anspruch, universal präsent zu sein, decke sich nicht unbedingt mit der Wirklichkeit. Die Sinus-Studie erweitere die anthropologische Wende, die das Zweite Vatikanische Konzil mit der Anerkennung der anonymen Gegenwart Gottes in jeder Existenz eingeläutet hat, um eine soziologische Perspektive. „Die Kirche muss davon ausgehen, dass jeder Mensch in seiner Geschichte die Offenbarung Gottes hören kann; sie muss mit Gott rechnen, auch wenn er nicht zur Sprache kommt“, betonte Sander. Die Sinus-Studie zeige nun, wie der Mensch Hörer des Wortes im Rahmen seines Milieus ist. Das fordere heraus, dem Problem der Sprachlosigkeit gegenüber bestimmten Gruppen nicht auszuweichen. Laut Sander geht es dabei um die Identität der Kirche.
Sie könne auf zwei Arten in den Blick rücken, die sich nicht ausschlössen, sondern in Spannung miteinander stünden: Wer ist Kirche und wo ist Kirche? Die Frage nach dem Subjekt ziele auf die Selbstbestimmung, ausgehend von den eigenen Stärken. Das könne zu einer Ausgrenzung der anderen führen. Die Frage nach dem Ort konfrontiere mit anderen Größen, zum Beispiel mit dem Umfeld. Dadurch sei die Auseinandersetzung mit den anderen unumgänglich. „Man muss die anderen geradezu einschließen, um selber identifizierbar zu sein. Wer sagt, wo er ist, setzt sich zu anderen in Beziehung.“ Auf diese Weise bekomme die Kirche eine Präsenz in der Welt von heute. „Wenn sich Kirche allein von sich selbst her präsentiert, steht sie sich im Weg. Sie erliegt der Utopie, überall gleichermaßen präsent zu sein und allgemeine Autorität zu besitzen.“ Um bestimmte Milieus zu erreichen, sei es unerlässlich, sich von den Themen der anderen her bestimmen zu lassen und deren Sprache und Orten anzunehmen. Es sei eine Zumutung, mit der Sprachlosigkeit leben zu lernen. Sie sei aber heilsam und führe in eine neue Sprache. „Nur wenn die Kirche sich eine innere Pluralität zumutet, andere Verortungen respektiert und die Stärken der anderen akzeptiert, wird sie ihrem Wesen gerecht.“
Die Grundlage hierfür seien die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dort erhebt die Kirche den Machtanspruch, dass Christus das Licht der Welt ist. Kirche könne nicht verfügen, dass Christus das Licht der Völker ist. „Wenn es aber gelingt, der Macht des Todes, des falschen Glaubens, der Sprachlosigkeit und der eigenen Religionsgemeinschaft nicht auszuweichen, kann sie Autorität gewinnen.“ Es sei gleichwohl eine große spirituelle Herausforderung, für alle da zu sein, auch für die Milieus, die man nicht versteht und deren Sprache man nicht spricht. Pastoral sei in diesem Zusammenhang zu verstehen als Fähigkeit, sich in der Welt von heute zu verorten. „Es gibt keinen menschlichen Lebensbereich, der nicht ein ‚locus theologicus’, ein Feld des Sprechens über den Glauben sein kann.“ Orte, an denen es um die menschliche Existenz gehe, seien keine Utopien, Nicht-Orte, sondern reale Orte. „Die Kirche hat die Fähigkeit, die realen Zeichen der Zeit zu verstärken, sich mit dem zu konfrontieren, was die Ordnung des Diskurses in Frage stellt, und echte Alternativen zu bieten“, resümierte Sander.
(4006/1327)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet